Heimat.bauen
Denkanstöße für eine baupolitische Wende
Was bedeutet es, Heimat zu bauen?
Ein Großteil unserer Städte wurde im Krieg zerstört. Das Wirtschaftswunderland der 1950er Jahre benötigte zweckmäßigen Wohnraum und Platz für Autos. Schneisen zogen sich durch die Reste der Altstädte. Die Nachkriegsmoderne wollte mit der Vergangenheit brechen. Heute scheint kaum jemand Ansprüche an die Gestalt gebauter Heimat zu stellen. Monotone Baukastenarchitektur wechselt sich ab mit exzentrischen Solitärbauten, die keine Rücksicht auf regionale Verortung und menschliches Maß nehmen. Dämmschichten und weitere energetische Auflagen lassen Materialität und Gliederungen von Fassaden verschwinden. Neubauten sehen überall gleich aus und sorgen für einen Verlust echter Vielfalt.
Immer schon herrschte ein fruchtbarer Dualismus zwischen Moderne und Tradition, Fortschritt und Heimatschutz, Bauhaus und Reformarchitektur, Neues Bauen und Gartenstadt, Funktionalismus und Fassadenschmuck. Heute ist der Baudiskurs entpolitisiert.
In den Lehrstühlen zementiert globaler Modernismus seine Deutungshoheit. In der Praxis zählen schneller Profit, individueller Komfort und ökologisch fragwürdige energetische Auflagen.
Es entstehen allerorts verödete Stadträume und endlose Schlafstädte in den Ballungsräumen. Ein Umdenken bei Verantwortungsträgern findet nicht statt. Auf der Strecke bleibt die Identifikationskraft unserer Wohnorte, die zunehmend schwindet. Gleichzeitig herrscht akuter Wohnraummangel in den Städten. Gerade die Mietpreise durchmischter Gründerzeitviertel explodieren, die jeder liebt, nach deren Prinzipien aber keiner mehr baut.
HEIMAT.BAUEN möchte Denkanstöße für eine baupolitische Wende geben. Es entstehen seit Jahren beispielhafte Bauprojekte wie Poundbury (UK) oder Brandevoort (NL), die nach traditionellen Prinzipien errichtet wurden und als leuchtende Beispiele dienen. Es gilt, die in Jahrhunderten durch Klima und Topografie geformte Bautradition mit ihren regionalen Ausformungen neu zu entdecken und an alte Erfahrungsschätze anzuknüpfen. HEIMAT.BAUEN muss als Imperativ verstanden werden.





HEIMAT BAUEN!
Regionale Baukultur und identitätsstiftende Architektur fördern
Städte und Gemeinden werden immer gesichtsloser. Investoren bebauen Wiesen und Brachflächen mit einfallsloser Baukastenarchitektur. Regionaltypische Architektur schafft Orte, mit denen man sich identifiziert. Auch heute noch.

Stadt und Land müssen leben!
Funktionale Mischung und Dichte statt Zersiedelung und Flächenfraß
Ballungsräume wachsen durch Zuzug aus In- und Ausland, junge Familien ziehen in die Vororte. Natürliche Rückzugsorte verschwinden und durch das zersiedelte Land zieht sich ein undefinierbarer Häuserteppich.
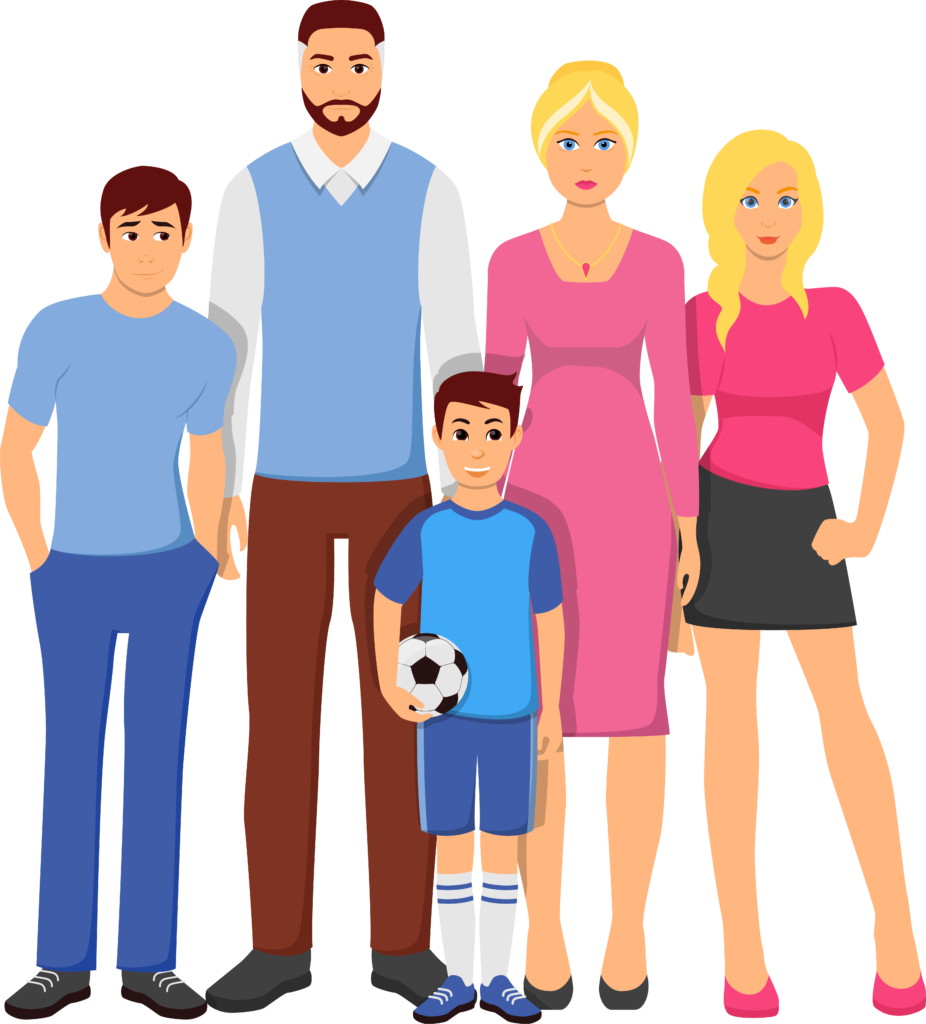
WOHNEIGENTUM FÖRDERN
Das Eigenheim als bester Ort für Familien
Die Familie ist unser gesellschaftliches Leitbild, das Eigenheim der beste Ort für familiären Zusammenhalt. Neben dem freistehenden Einfamilienhaus gibt es noch weitere Möglichkeiten.

BÜROKRATIE ABSCHAFFEN
Energetische Auflagen ökologisch oftmals Unsinn
Der Klimawahn macht vor dem Baugewerbe nicht Halt. Gebäudeenergiegesetz, Dämmvorschriften und EU-Richtlinien treiben die Auflagen ins Unermessliche und verteuern künstlich das Bauen – und das oft ohne ökologischen Nutzen.

Gegen den Wachstumsdruck!
Baulobbyismus hinterfragen, Leerstände nutzen, Umwelt schonen
Bauen ist ein großes Geschäft, an dem viele verdienen. Oft wird bewusst am Bedarf vorbei gebaut, Angebot künstlich verknappt, Leerstand ignoriert und die Ausweisung von Bauland kritiklos hingenommen.
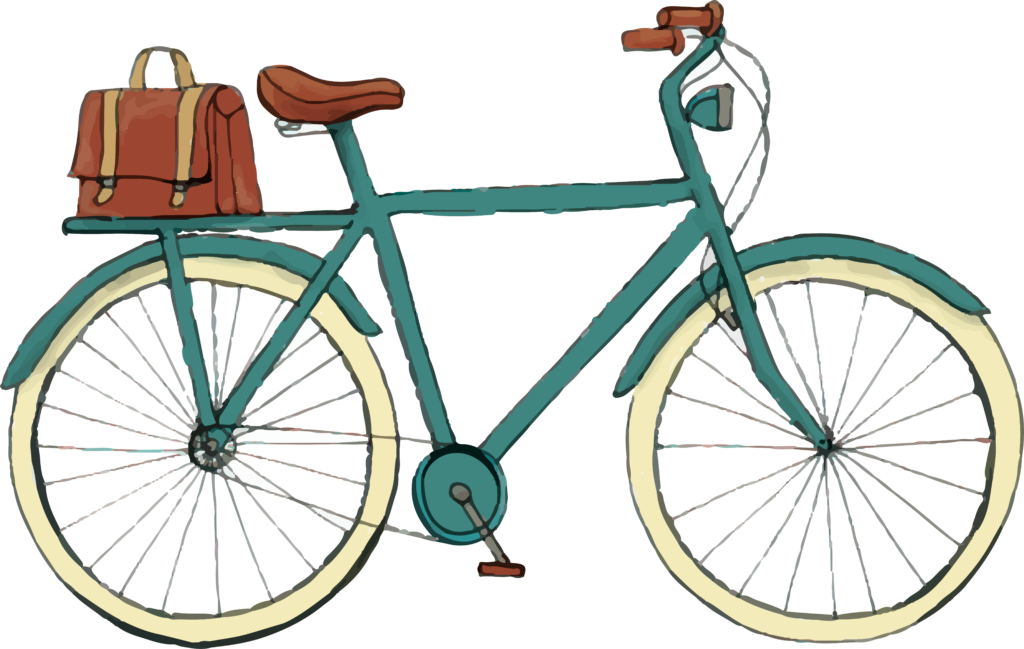
KEIN DOGMA DES AUTOS
Das Fahrrad ist
konservativ
Die „autogerechte Stadt“ ist ein Auslaufmodell. Das Auto ist für viele Menschen unverzichtbar, weshalb grüne Verbotspolitik keine Lösung bietet. Doch dürfen wir andere Verkehrsarten nicht aus dem Blick verlieren.
POSITIONSPAPIER
Ich habe das Projekt HEIMAT.BAUEN ins Leben gerufen, um die Themen regionale Baukultur, identitätsstiftende Architektur und funktionsgemischter Städtebau der AfD ins Bewusstsein zu rufen. Den Auftakt bildeten meine zehn baupolitischen Thesen. Eine umfangreiche Studie, die auf den Thesen aufbaut, ist bereits in Arbeit.
Es wird Zeit für eine baupolitische Wende!
LITERATUR
Architektur und regionale Baukultur:
- Bund Heimat und Umwelt in Deutschland: Regionale Baukultur als Beitrag zur Erhaltung von Kulturlandschaften.
- D. Wieland: Gebaute Lebensräume.
- H. Kollhoff: Architektur. Schein und Wirklichkeit.
- J. Kottjé: Moderne Häuser in regionaler Tradition. Bewährte Bauformen neu interpretiert.
- N. Borrmann: „Kulturbolschewismus“ oder „Ewige Ordnung“. Architektur und Ideologie im 20. Jahrhundert.
Städtebau und New Urbanism:
- A. Duany: Smart Growth Manual. New Urbanism in American Communities.
- A. Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte.
- E. Talen: Charter the New Urbanism.
- J. Jacobs: Tod und Leben großer amerikanischer Städte.
- L. Krier: Freiheit oder Fatalismus.
- R. Krier: Stadtraum in Theorie und Praxis.
- V. Magnago Lampugnani: Die Modernität des Dauerhaften. Essays zu Stadt, Architektur und Design.
- W. Sonne: Der Wiederaufbau urbaner Stadtquartiere im Ruhrgebiet.
- W. Sonne: Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. Jahrhunderts.
Energetisches Bauen:
- C. Mäckler, M. Kaune, M. Motz: Stadtbild und Energie. Nachhaltige Stadtentwicklung durch energetische Optimierung, dauerhaftes Bauen und identitätsfähige Stadtbilder
- M. de Saldanha: Smart bauen. Architektonische und technische Strategien für energieoptimierte Gebäude, Quartiere und Städte.
- P. Liedl, B. Rühm: Gesundes Bauen und Wohnen. Baubiologie für Bauherren und Architekten.
- T. Duzia, R. Mucha: Energetisch optimiertes Bauen. Technische Vereinfachung – nachhaltige Materialien – wirtschaftliche Bauweisen.
Heimatschutz- und Reformarchitektur (historisch):
- E. Rudorff: Heimatschutz.
- H. Andresen: Bauen in Backstein.
- P. Schultze-Naumburg: Flaches oder geneigtes Dach? Mit einer Rundfrage an deutsche Architekten und deren Antworten.
- P. Schmitthenner: Das deutsche Wohnhaus.
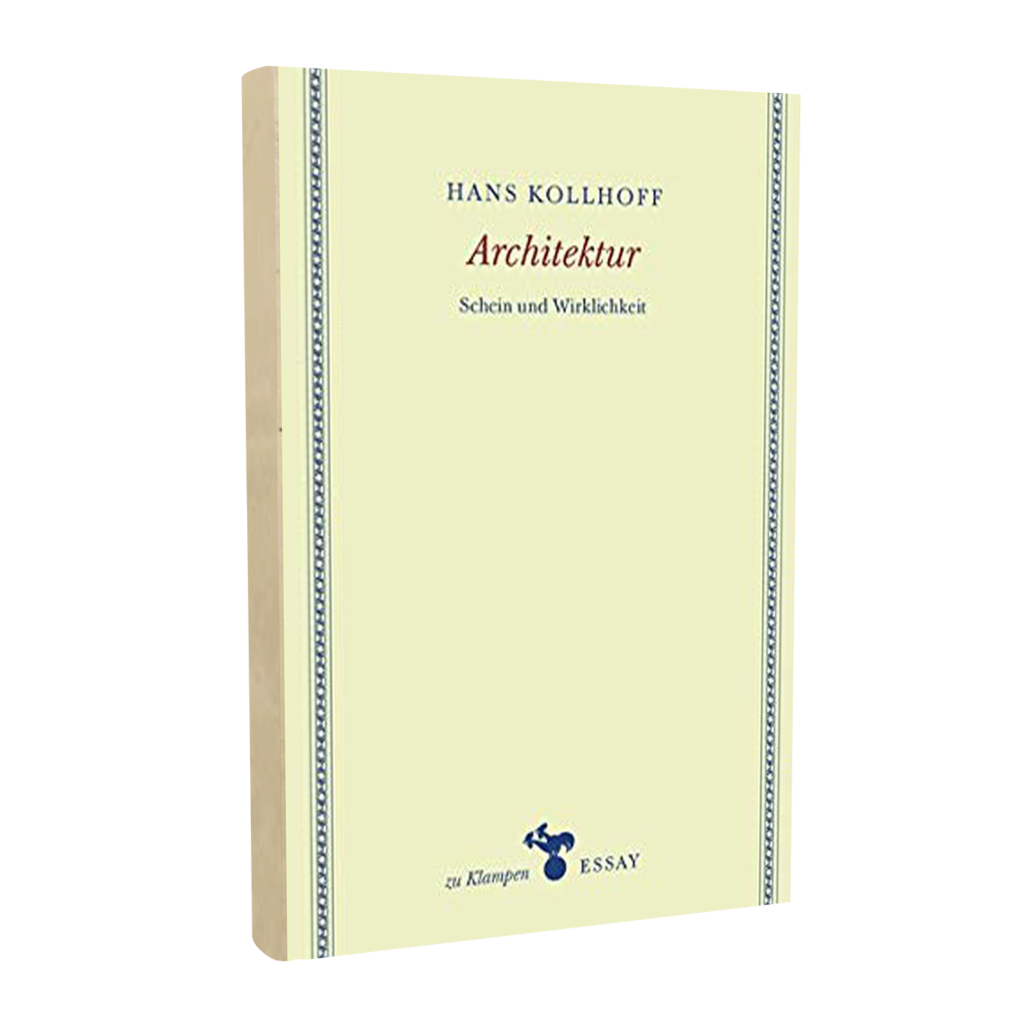
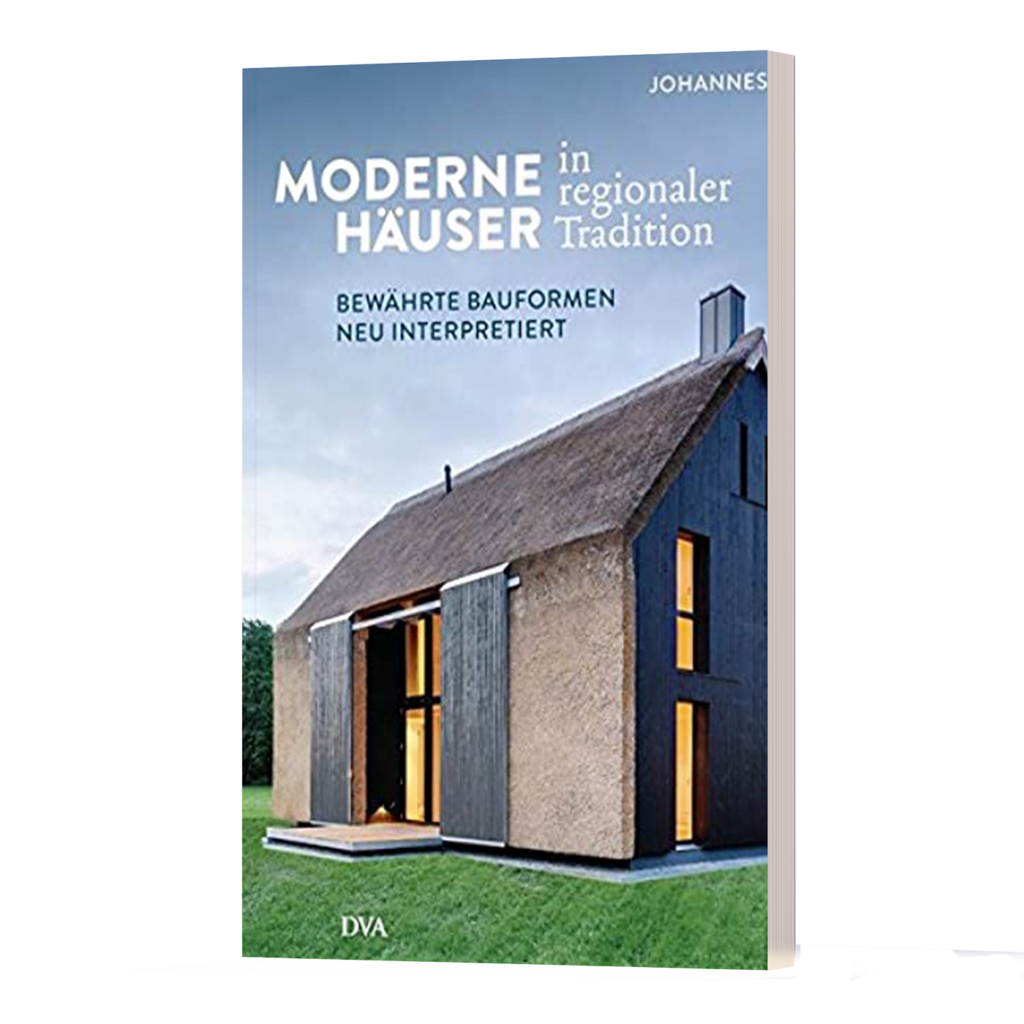
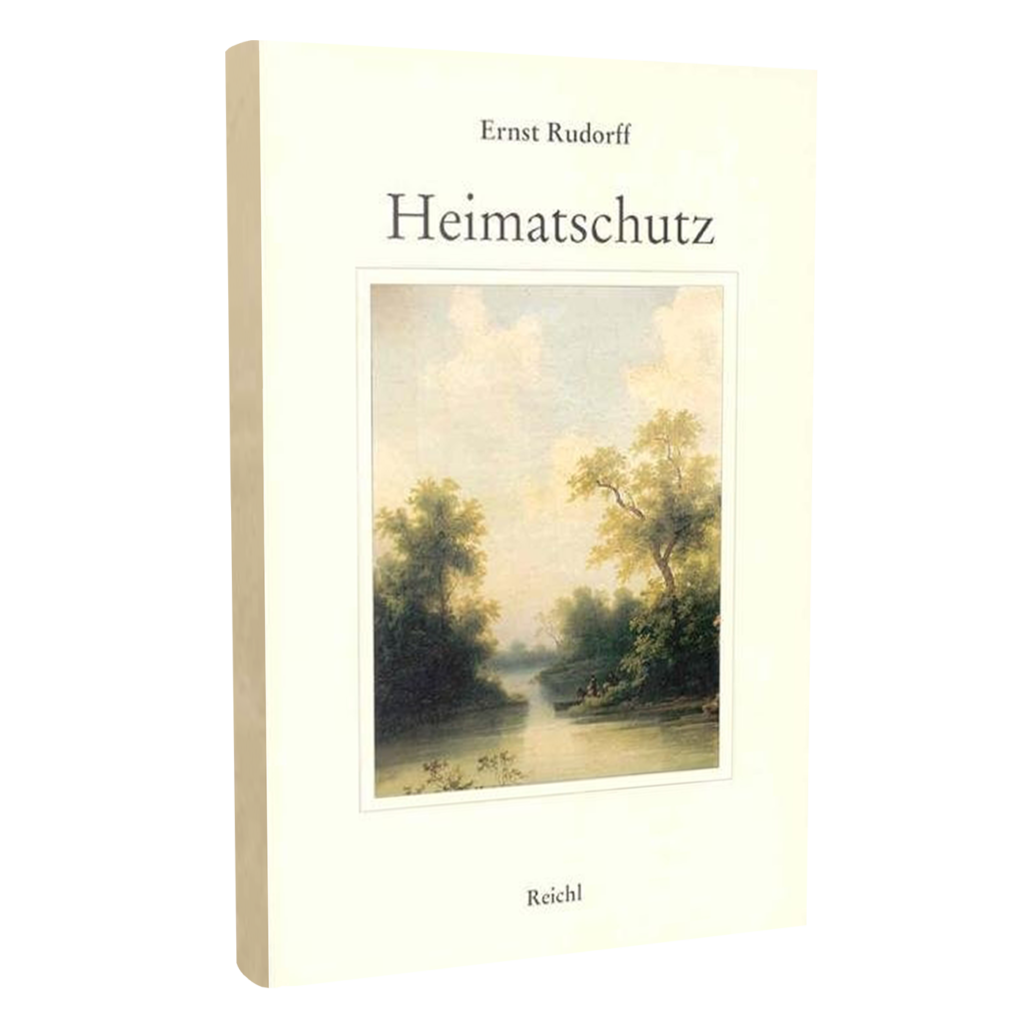
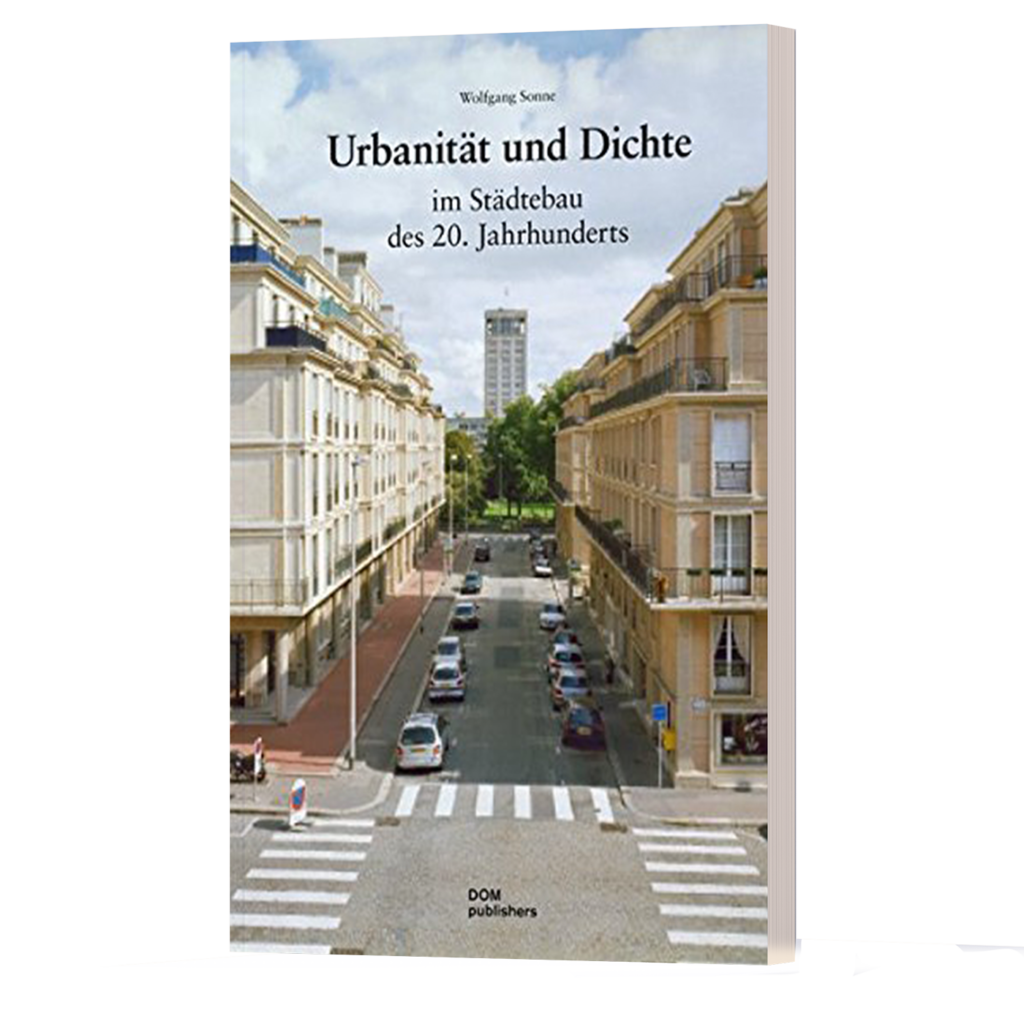

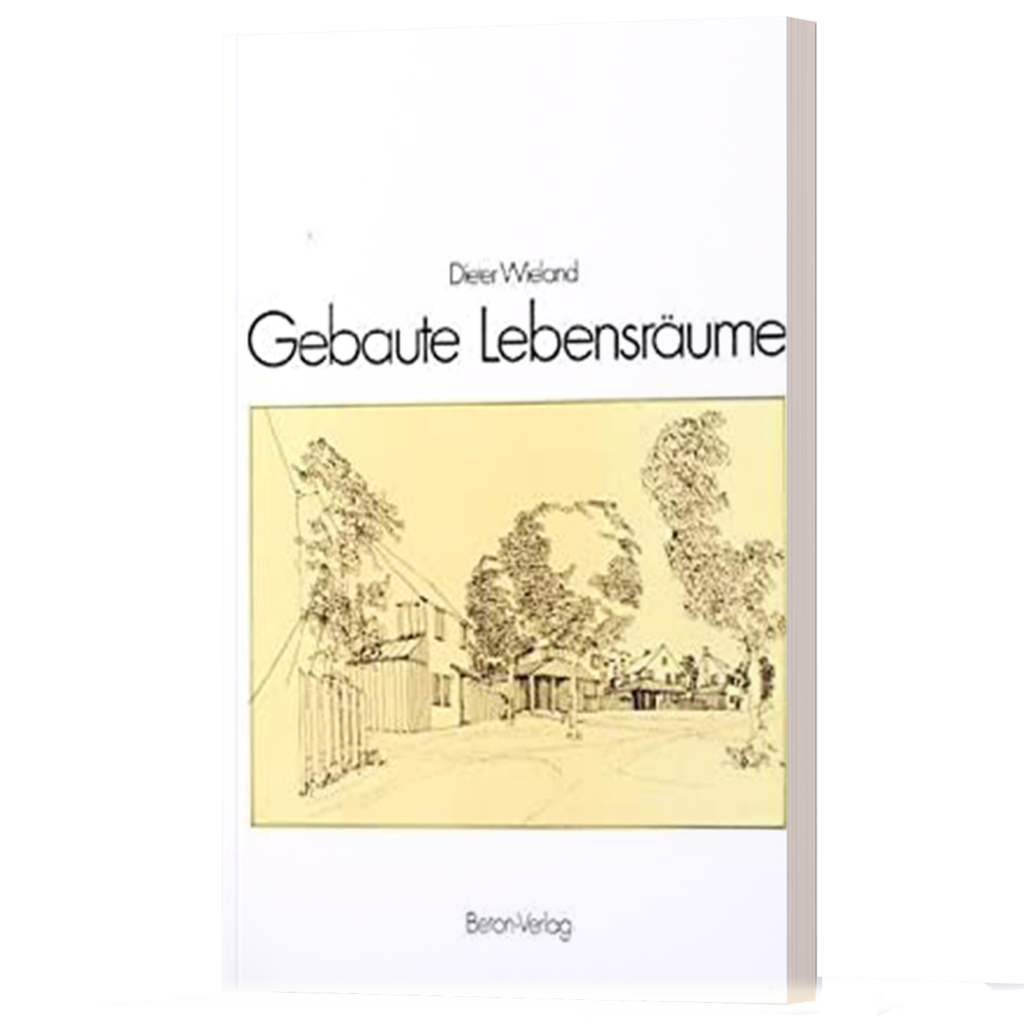
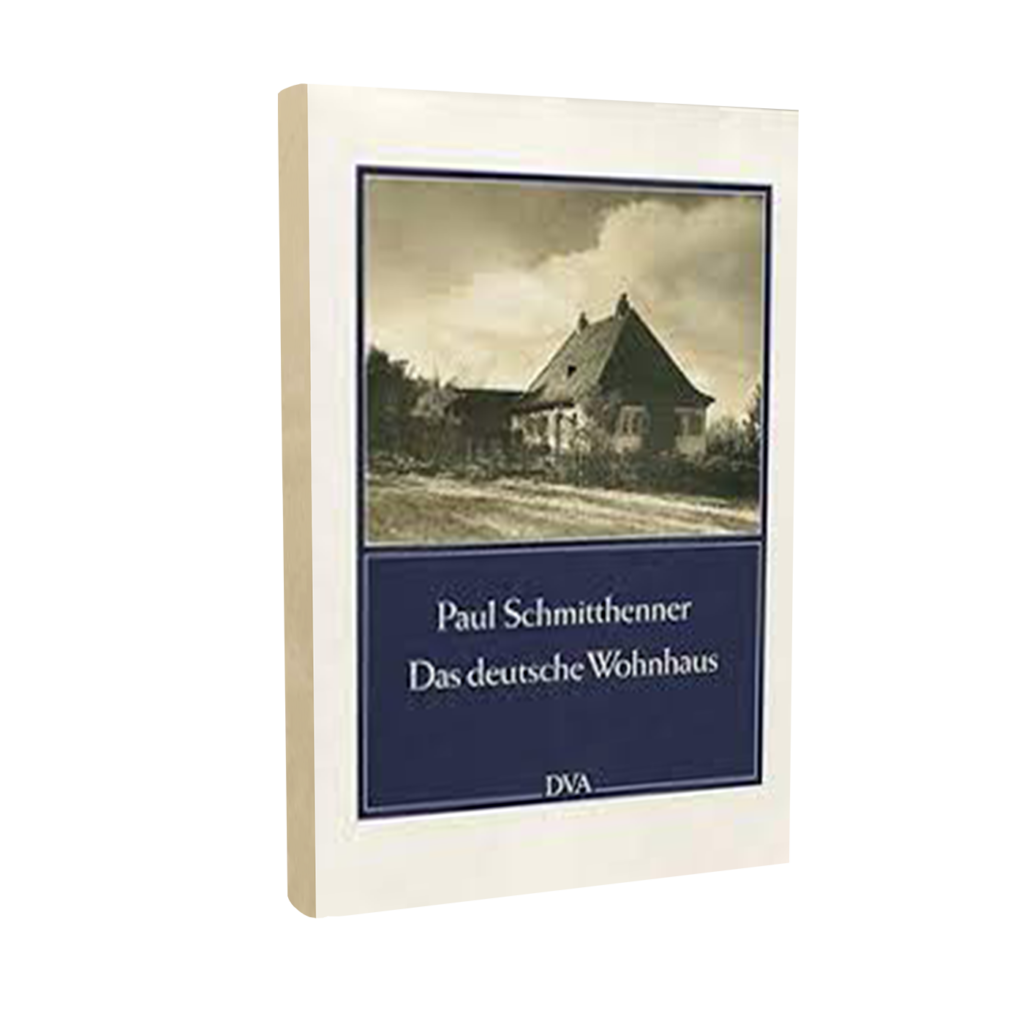
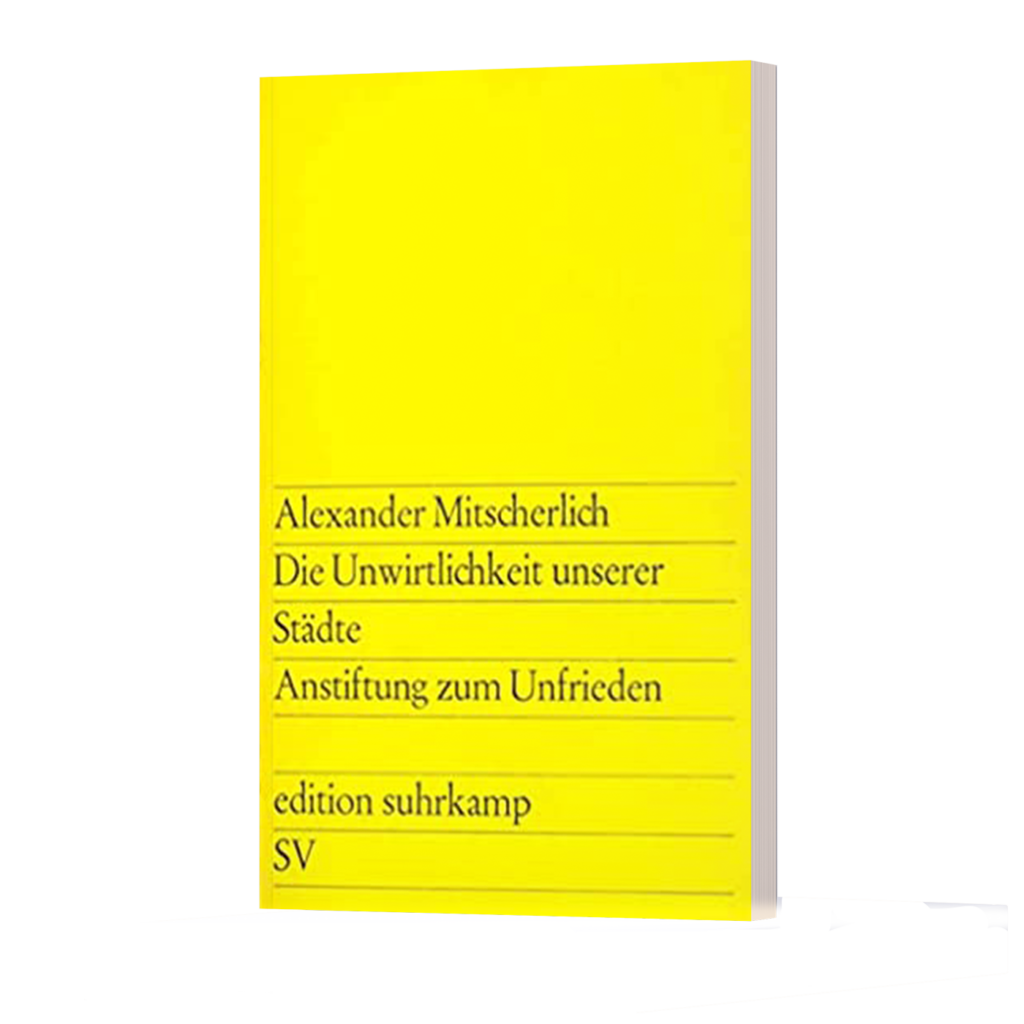
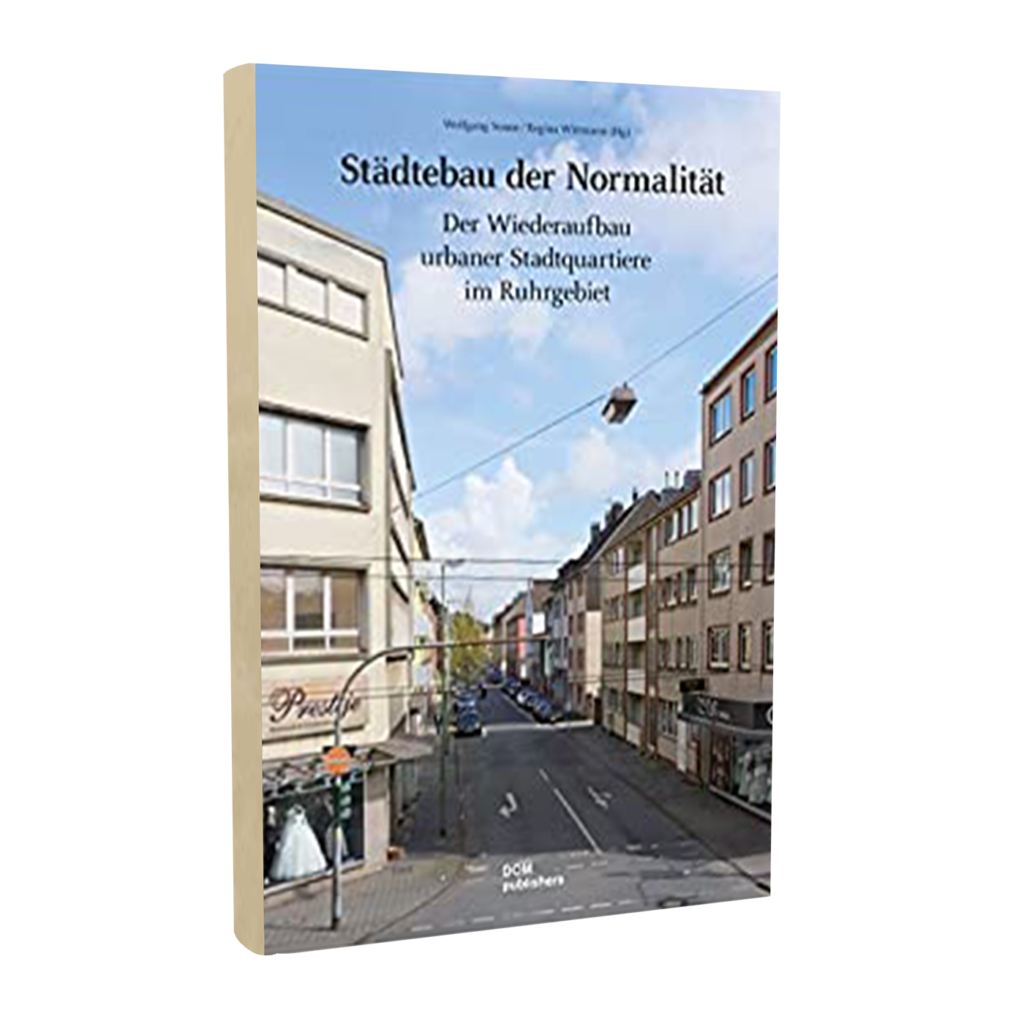

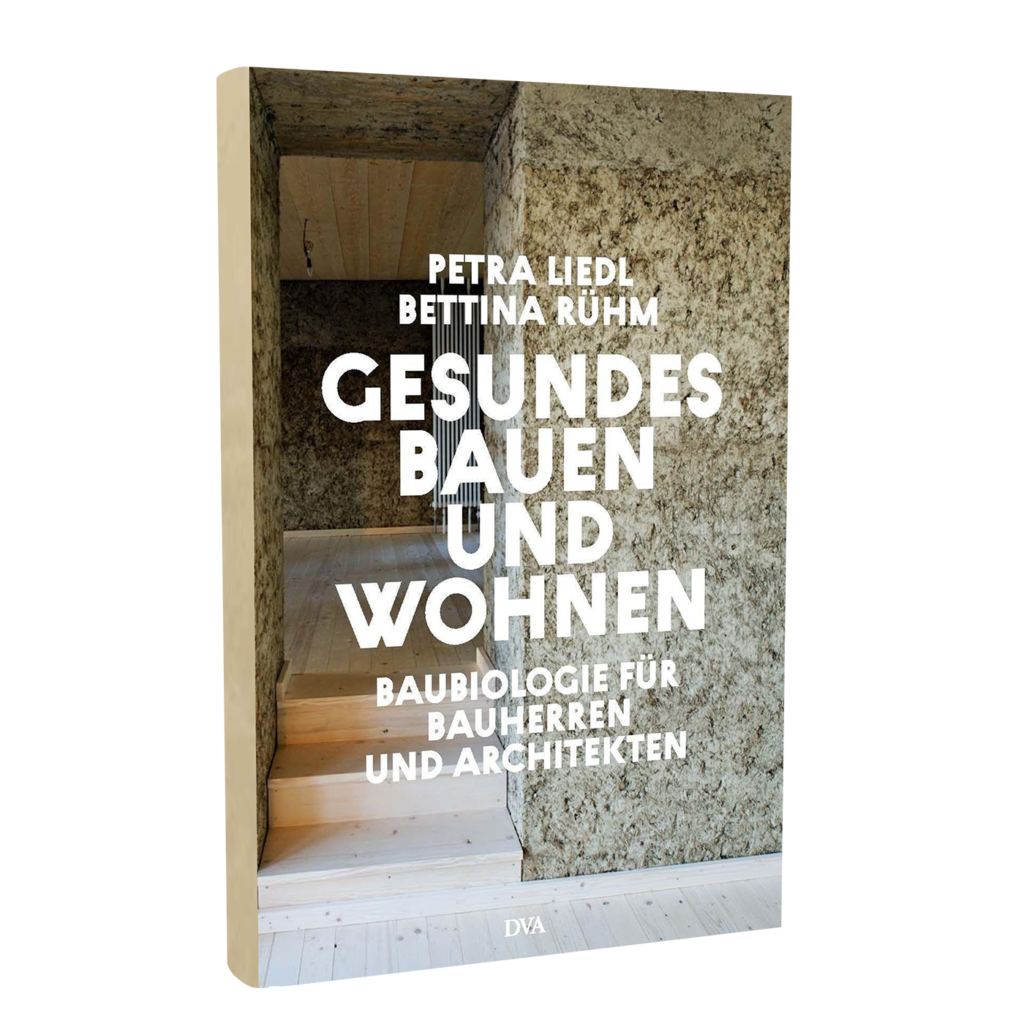
Kontakt
carlo.clemens@jungealternative.online
